Schluckstörungen betreffen viele Menschen – besonders im Alter, nach einem Schlaganfall oder bei neurologischen Erkrankungen. Wenn Flüssigkeiten zu schnell fließen, wird die Nahrungsaufnahme zur Herausforderung. Andickungsmittel schaffen Abhilfe und ermöglichen eine sichere Ernährung. Dieser Ratgeber erklärt Anwendung, Dosierung und empfiehlt passende Produkte bei Schluckbeschwerden.
Was sind Andickungsmittel und wie wirken sie?
Andickungsmittel sind Pulver, welche die Konsistenz von Flüssigkeiten und Speisen verändern. Sie binden Wasser und machen Getränke sowie Nahrung dickflüssiger. Das verlängert die Zeit, in der die Nahrung im Mund bleibt, und gibt Betroffenen mehr Kontrolle beim Schlucken. Durch das Andicken sinkt das Risiko, dass Flüssigkeiten in die Luftröhre gelangen.
Die meisten Andickungspulver enthalten Maltodextrin, modifizierte Stärke oder Xanthan. Diese Inhaltsstoffe sind geschmacksneutral und beeinflussen weder Farbe noch Geschmack der Speisen. Menschen mit Dysphagie können damit ihre gewohnten Getränke und Mahlzeiten sicher genießen.
Für wen eignen sich Andickungsmittel?
Instant Andickungspulver kommt bei Personen mit Schluckstörungen zum Einsatz. Nach einem Schlaganfall leiden viele Patienten an einer gestörten Schluckfunktion. Neurologische Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose führen ebenfalls häufig zu Schluckbeschwerden und bei onkologischen Erkrankungen im Hals- und Rachenbereich treten ähnliche Probleme auf.
Ältere Menschen sind häufig betroffen, da die Muskulatur nachlässt und der Schluckreflex schwächer wird. Aber auch Kinder mit Entwicklungsstörungen benötigen mitunter angepasste Konsistenzen. In diesen Fällen ist das Diätmanagement mit Andickungsmitteln eine wichtige Therapie zur Unterstützung der Betroffenen.
Die verschiedenen Konsistenzstufen
Andickungsmittel bieten eine flexible Dosierung, sodass die Konsistenz, je nach Schweregrad der Dysphagie, angepasst werden kann. Es gibt drei Hauptstufen:
Stufe 1 – Sirupartig: Für leichte Schluckbeschwerden. Das Getränk fließt langsamer als Wasser. Dosierung: etwa 1 Messlöffel pro 100 ml.
Stufe 2 – Honigartig: Für moderate Schluckstörungen. Die Flüssigkeit läuft deutlich langsamer. Dosierung: etwa 1,5 Messlöffel pro 100 ml.
Stufe 3 – Puddingartig: Bei schweren Schluckstörungen. Die Nahrung ist nahezu löffelfest. Dosierung: etwa 2 Messlöffel pro 100 ml Flüssigkeit.
Die genaue Menge variiert je nach Produkt. Lassen Sie sich beraten, welche Stufe für Sie die richtige ist.
Anwendung und Zubereitung: So geht’s richtig
Die Verwendung von Andickungsmitteln ist unkompliziert. Die meisten Produkte sind Instant Andickungspulver und lösen sich in der Flüssigkeit schnell auf:
- Messen Sie die Flüssigkeitsmenge ab – Wasser, Tee, Saft, Suppen oder Trinknahrung.
- Geben Sie die entsprechende Menge Andickungspulver mit dem Messlöffel hinzu.
- Rühren Sie sofort kräftig um.
- Lassen Sie die angedickte Flüssigkeit kurz ruhen – zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten.
- Prüfen Sie die Konsistenz und passen Sie diese bei Bedarf an.
Die meisten Andickungsmittel sind für kalte und warme Getränke und Speisen geeignet. Achten Sie bei der Auswahl der Produkte darauf, dass die Pulver nicht nachdicken. Das ist ein Qualitätsmerkmal guter Produkte.
Tipps für den Einsatz im Alltag
- Bereiten Sie Getränke immer frisch zu, da manche Produkte bei langem Stehen ihre Konsistenz verändern.
- Für unterwegs eignen sich Sachets mit Einzelportionen.
- Für mehr Variation im Speiseplan können Sie auch Suppen, Soßen und pürierte Speisen andicken.
- Achten Sie auf eine einheitliche Konsistenz aller Lebensmittel.
- Bewahren Sie Pulver-Dosen oder -Verpackungen kühl und trocken auf und verschließen Sie die Produkte nach Gebrauch gut.
Welche Andickungsmittel gibt es bei Dysphagie?
Der Markt bietet verschiedene Andickungsmittel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten Produkte vor, die auch im RCS-Pro Shop erhältlich sind.
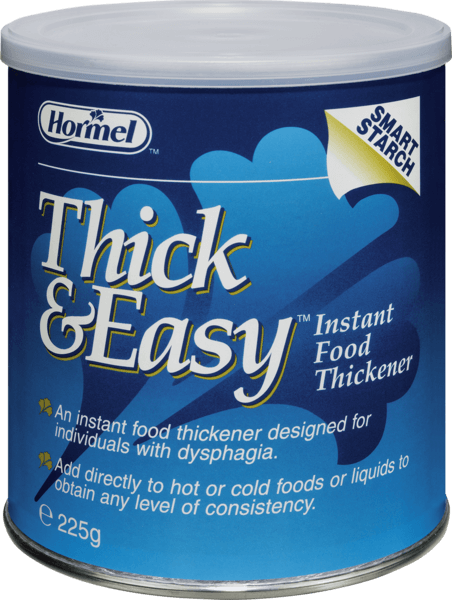
Thick & Easy von Fresenius Kabi
Thick & Easy ist ein bekanntes Andickungsmittel auf dem Markt. Das Instant Andickungspulver ist geschmacks- und geruchsneutral und gibt 98% der gebundenen Flüssigkeit im Darm wieder frei. Das ist wichtig zur Vorbeugung von Dehydrierung. Thick & Easy eignet sich für Personen mit Schluckstörungen bei neurologischen oder onkologischen Erkrankungen und unterstützt das Schlucktraining. Erhältlich ist das Pulver im RCS-Pro Shop in der praktischen und gut wieder verschließbaren 225g-Dose.
Nutilis Powder von Nestlé
Nutilis ist ein weiteres Top-Produkt für Menschen mit Dysphagie. Es eignet sich hervorragend zum Andicken von Getränken und Speisen und ist sowohl gluten- als auch laktosefrei. Die Zubereitung gelingt problemlos in kalten und warmen Flüssigkeiten. Nutilis Powder ist amylaseresistent, was bedeutet, dass die gewünschte Konsistenz auch bei Speichelkontakt stabil bleibt. Das ist besonders wichtig, wenn das Essen länger im Mund verweilt. Das Pulver ist in verschiedenen Dosengrößen sowie als praktische Sachets à 12g im RCS-Pro Shop erhältlich.


Nutilis Clear für klare Flüssigkeiten
Ein besonderes Produkt ist Nutilis Clear – das transparente Andickungsmittel. Klare Flüssigkeiten wie Wasser, Tee oder Saft bleiben mit dem Produkt auch nach dem Andicken klar. Dies ist für die Akzeptanz bei Betroffenen von großer Bedeutung. Nutilis Clear ist amylaseresistent und ermöglicht ein Andicken in allen drei Konsistenzstufen. Die Dose mit 175g ist praktisch für den häuslichen Gebrauch.
ThickenUp von Nestlé
Nestlé ThickenUp ist ein geschmacksneutrales Andickungsmittel zum Andicken von Getränken, Suppen, Soßen und pürierten Speisen. Es ist sowohl in kalten als auch warmen Speisen anwendbar, klumpt nicht und dickt nicht nach. Die gebundene Flüssigkeit wird im Darm wieder freigesetzt, was für eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung sorgt. Das Produkt ist in Dosen à 227g sowie auch als durchsichtiges Andickungsmittel ThickenUp Clear im RCS-Pro Shop verfügbar. Beide Produkte eignen sich hervorragend für das Diätmanagement bei Patienten mit Schluckstörungen.

Wie wird die richtige Dosierung ermittelt?
Die korrekte Dosierung ist entscheidend für Sicherheit und Erfolg der Therapie. Der behandelnde Arzt oder Logopäde gibt nach einem Schlucktest eine entsprechende Empfehlung. Halten Sie sich an diese Vorgaben und passen Sie die Menge des Andickungsmittels an. Auf jeder Verpackung finden Sie Dosierungsempfehlungen, welche sich meist auf 100 ml Flüssigkeitsmenge beziehen.
Beachten Sie: Verschiedene Getränke benötigen unterschiedlich viel Pulver. Wasser und Tee dicken leichter an als säurehaltige Säfte oder Milch. Notieren Sie die benötigte Menge für Ihre Lieblingsgetränke.
Besondere Hinweise zur Verfügung
Andickungsmittel sind diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und sollten nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Sie dienen dem Diätmanagement bei Schluckstörungen.
Es gibt Situationen, in denen Andickungsmittel nicht geeignet sind: bei Kontraindikation der enteralen Ernährung, akuten gastrointestinalen Blutungen oder Darmverschluss. Auch bei Unverträglichkeiten gegen Inhaltsstoffe verzichten Sie besser auf die Verwendung. Für Kinder unter drei Jahren sind viele Andickungsmittel ebenfalls nicht geeignet.
Andickungsmittel und Trinknahrung kombinieren
Menschen mit Dysphagie benötigen oft hochkalorische Trinknahrung für ihren Nährstoffbedarf. Andickungsmittel lassen sich problemlos mit Trinknahrung kombinieren. Trinknahrung ist meist dickflüssiger als Wasser, daher kann die benötigte Menge an Andickungspulver geringer ausfallen. RCS-Pro bietet neben Andickungsmitteln auch Trinknahrung für verschiedene Bedürfnisse.
Häufig gestellte Fragen zu Andickungsmitteln
Welche Andickungsmittel werden bei Dysphagie eingesetzt?
Bei Dysphagie kommen verschiedene Andickungsmittel zum Einsatz, die speziell für die Behandlung von Schluckstörungen entwickelt wurden. Zu den bekanntesten Produkten gehören Thick & Easy von Fresenius Kabi, Nutilis und Nutilis Clear von Danone sowie Nestlé ThickenUp und Jonova. Diese Produkte sind als bilanzierte Diät für besondere medizinische Zwecke zugelassen und ermöglichen das sichere Andicken von Flüssigkeiten und Speisen in verschiedene Konsistenzstufen.
Welche Andickungsmittel eignen sich bei Schluckstörungen?
Bei Schluckstörungen eignen sich besonders amylaseresistente Andickungsmittel, da diese ihre Konsistenz auch bei längerem Speichelkontakt beibehalten. Produkte wie Nutilis, Nutilis Clear und Thick & Easy erfüllen diese Anforderung. Sie sind geschmacks- und geruchsneutral, lassen sich einfach dosieren und funktionieren sowohl in kalten als auch warmen Getränken. Für unterwegs sind Sachets praktisch, während für den häuslichen Gebrauch größere Dosen zur Verfügung stehen.
Welches Medikament wird bei Dysphagie eingesetzt?
Andickungsmittel sind keine Medikamente im klassischen Sinn, sondern diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Sie behandeln nicht die Ursache der Dysphagie, sondern ermöglichen eine sichere Nahrungsaufnahme trotz Schluckbeschwerden. Die eigentliche Behandlung der Dysphagie erfolgt durch Logopädie, Schlucktraining oder, je nach Ursache, durch die Therapie der Grunderkrankung. Andickungsmittel sind eine unterstützende Maßnahme im Rahmen der gesamten Behandlung.













